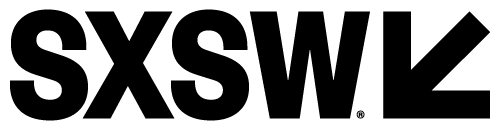Im Rahmen ihres Engagements zur Digitalisierung und Gesellschaft besuchte die Stiftung Risiko Dialog diesen März die Interactive Conference des South by Southwest (SXSW) in Austin (Texas). Es ist eines der grössten Technologiefestivals mit 75’000 Besuchern aus aller Welt. Dort konnten wir Einblicke in die Zukunftswelten der Digitalisierung gewinnen. Forscher, Firmen und Länder warben in Panels, Keynotes, Workshops und Ausstellungshallen um die Gunst des Publikums.
Die diesjährige Ausgabe setzte ihre Schwerpunkte auf den Themen «Artificial Intelligence» (dt. künstliche Intelligenz), «Misinformation» (dt. Fehlinformation) und «Regulation der Techfirmen». Der Spiegel titelte im Anschluss an die Konferenz „Der Silicon Dream ist aus“ und stellt damit fest, dass sich der grenzenlose Technologie-Optimismus Amerikas zum populären Skeptizismus gewandelt hat.
Das immense Potenzial von Artificial Intelligence (AI) scheint bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Die jetzigen noch limitierten Anwendungen sind lediglich erste Schritte hin zu komplexeren Einsätzen. Die Frage bleibt offen, wie künstliche Intelligenz unser Leben nützlich und wohlgesinnt gestalten kann, ohne, beispielsweise durch eine unüberlegte Implementierung, zum schleichenden Risiko zu werden. Vor allem auch aus ethischer Sicht muss der Einsatz von AI diskutiert werden. Welche Konsequenzen haben mögliche einprogrammierte und aufgrund der Quell-, Struktur- und Trainingsdaten erlernte Bias auf Entscheidungen und was bedeutet das für uns Menschen? Diese müssen diskutiert werden, bevor uns der Einsatz von AI in der Justiz, im Bankensektor oder am Arbeitsplatz vor neue Herausforderungen stellt. So fordern auch die Vortragenden bzw. Panelisten mehr Transparenz. Die könnte mittels Open Source-, Open Data-Lösungen geschehen.
Misinformation zeigen sich gemäss einer aktuellen Studie signifikant robuster innerhalb der sozialen Netzwerke als validierte Meldungen. Sie erreichen mehr Personen, dringen tiefer in soziale Netzwerke ein und verbreiten sich schneller.
Eine spezifische Kategorie von Misinformation sind die Deepfakes. In sie fallen technologisch konstruierte Bilder bzw. Videos, die auf Basis neuronaler Netzwerke erstellt wurden und einen täuschend echten Inhalt vermitteln. Reuters, die weltweit führende Nachrichtenagentur, hat zusammen mit dem Max-Planck-Institut in einem Versuch untersucht, was Parameter sind, um solche Deepfakes besser erkennen zu können. Daraus geht hervor, dass bei allen personenzentrierten Videos, die einen verstärkten Neuigkeitseffekt aufweisen, das Augenmerk auf die Audio-Bild-Schere – spezifisch auf die Mundregion bei Zischlauten und Schärfe des Mundinnenraums – gelegt werden soll. Auch die statische Haltung einer dargestellten Person kann verraten, dass versucht wurde mit kleinstmöglichen Veränderungen ein Deepfake zu schaffen: Je weniger Parameter eines Körpers bzw. Gesichts kontrolliert werden müssen, desto effizienter die Erstellung eines Deepfakes.
Im Themenfeld Regulation von Techfirmen haben Kongresspersonen, PräsidentschaftsanwärterInnen und europäische Vertreter verschiedene, teilweise vage Konzepte zur Eindämmung der anhaltenden Aushöhlung der Privatsphäre vertreten. In einem Panel wurde eloquent konstatiert, dass aktuell der Einsatz von Daten in Europa auf eine Privatsphäre-schützende, in China auf eine bevölkerungskontrollierende und in den USA auf eine kommerzialisierte Art gehandhabt wird. Die europäische Datenschutz-Grundverordnung und das im Januar 2020 eingeführte kalifornische Digital-Privatsphäre-Gesetz stellen für viele Länder spannende Piloten dar, welche wegweisende Implikationen generieren.
Mit einer grossen Bandbreite an Veranstaltungsformen, Vortragenden aus Wirtschaft, Wissenschaft, Non-Profit und Behörden und den parallel stattfindenden Konferenzen aus Film, Gaming und Musik konnte die «interactive Conference» des SXSW einen Raum für interdisziplinäre Ansichten und kreative Konzeptideen schaffen. Diese Form von unterschiedliche, aber vertieftem Austausch braucht es, um die ethische Herausforderung der Digitalisierung anzugehen.
Nathalie Stübi